Inhaltsstoffe, Futterwert und Einsatz von Ackerbohnen in der Nutztierfütterung
Autoren:
Prof. Dr. Hansjörg Abel, Georg-August-Universität Göttingen
Dr. Wolfgang Sommer, Landwirtschaftschaftskammer Nordrhein-Westfalen Münster
Dr. Jürgen Weiß, Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz Kassel
Zum Download
Seit alters her gelten Körnerleguminosen als wertvolle Kulturpflanzen der Landwirtschaft. Sie bieten Möglichkeiten zu aufgelockerten Fruchtfolgen und leisten durch Bindung von Luftstickstoff mit Hilfe von Knöllchenbakterien einen wichtigen Beitrag zur umweltfreundlichen regenerativen N-Versorgung im Ackerbau. Fruchtfolgen mit Körnerleguminosen benötigen geringere Mengen an mineralischem N-Dünger und tragen so ebenfalls zur Senkung der Produktionskosten bei. In der Tierernährung fanden Ackerbohnen bereits im Altertum Verwendung als „kraftvolle Futtermittel”. Heutzutage sind sie als heimische Erzeugnisse geeignet, Teile importierter Futterkomponenten zu ersetzen.
Als Futtermittel dienen kleinsamige Artengruppen mit Tausendkorngewichten von 300 bis 500 g. Gemäßigte kühlfeuchte Klimate und mittlere bis schwere, tiefgründige Böden mit guter Puffer- und Wasserspeicherkapazität bzw. Grundwassernähe bilden die Voraussetzungen für hohe Erträge. In modernen Zuchtprogrammen sind Ackerbohnensorten mit hoher Ertragsfähigkeit und verbesserter Anbau- und Erntesicherheit entwickelt worden. Buntblühende Sorten gelten im Vergleich zu weiß-blühenden als widerstandsfähiger gegen bodenbürtige Krankheiten. Inzwischen liegen Forschungsergebnisse auch zum Futterwert und zu Einsatzmöglichkeiten verschiedener Ackerbohnensorten in der Tierernährung vor.
Inhaltsstoffe der Ackerbohne
Ackerbohnen enthalten vor allem Rohprotein und Stärke, deren Anteile von Blütenfarbe, Sorte, Standort und Anbaujahr abhängen. In Tabelle 1 sind aus neueren Untersuchungen Gehaltsbereiche für wertbestimmende Inhaltsstoffe im Vergleich zu Sojaextraktionsschrot und Weizen zusammengestellt.

Wie bei allen Futtermitteln sind die Inhaltsstoffe Schwankungen unterworfen, die innerhalb der Sorten größer sind als zwischen diesen. Die für Ackerbohnen ausgewiesenen Mittelwerte zeigen im Vergleich zu Sojaextraktionsschrot und Weizen, dass der Rohproteingehalt etwa zwischen beiden und der Stärkegehalt näher am Wert des Weizens liegt. Ackerbohnen sind somit sowohl als Protein- als auch als Energielieferanten einzuordnen.
In Ackerbohnen kommen – wie in vielen anderen Hülsenfrüchten auch – so genannte sekundäre Inhaltsstoffe wie z. B. Tannine oder das ackerbohnenspezifische Vicin vor, die in höheren Konzentrationen bei Schweinen und Geflügel ungünstig wirken. Tannine wirken sich negativ auf die Protein- bzw. Aminosäurenverdaulichkeit bei Geflügel und Schweinen aus. In der Wiederkäuerernährung ist diese Wirkung aufgrund der dadurch veränderten Abbaubarkeit von Nährstoffen im Pansen dagegen vorteilhaft. Das Vicin beeinträchtigt die Legeleistung von Hennen. Wenn ein verstärkter Einsatz von Ackerbohnen geplant ist, sollten Legehennenhalter die neugezüchteten vicinarmen Sorten verwenden. Neben Aspekten, die sich aus der Energie- und Nährstoffoptimierung ergeben, werden auch zur Vermeidung unerwünschter Effekte durch die genannten sekundären Inhaltsstoffe Obergrenzen für Ackerbohnen in der Fütterung empfohlen, bei deren Einhaltung keine negativen Auswirkungen auf die Futteraufnahme, die Futterverwertung oder die Leistung der Tiere auftreten. Die Gehalte an diesen Stoffen sind bei Ackerbohnen in erster Linie sortenbedingt. So weisen z. B. buntblühende Sorten höhere, weißblühende Sorten niedrigere Tanningehalte auf. Weitere Informationen hierzu werden in den Empfehlungen zum Einsatz gegeben.
Bei erhöhtem Wassergehalt des Erntegutes kann es bei der Lagerung zu Schimmelbildung kommen. Die dadurch entstehenden Pilztoxine können die Tiergesundheit und Leistung negativ beeinflussen. Es ist darauf zu achten, dass der Wassergehalt der Ackerbohnen bei der Einlagerung maximal 12 % beträgt. Dies ist durch eine ausreichend große Anzahl an Feuchtemessungen möglichst exakt abzusichern. Bei Körnerleguminosen sind innerhalb einer Erntepartie mitunter erhebliche Streuungen zu erwarten. Besonders gilt dies für ungleichmäßig abgereifte Bestände. Bei höheren Wassergehalten ist neben der Trocknung auch eine Feuchtkonservierung mit organischen Säuren praktikabel.
Futterwert
Für den Futterwert ist neben dem Rohproteingehalt dessen ernährungsphysiologische Qualität und der sich aus der Verdaulichkeit der Nährstoffe ergebende energetische Futterwert von Bedeutung. Da beide Bereiche für Monogastrier (Schweine, Geflügel) sowie für Wiederkäuer unterschiedlich zu beurteilen sind, werden die Kennwerte entsprechend differenziert in den Tabellen 2 und 3 dargestellt. Die Proteinqualität wird in der Schweine- und Geflügel-ernährung durch die Gehalte an den wichtigsten Aminosäuren charakterisiert. Dies sind Lysin, Methionin + Cystin, Threonin und Tryptophan. Zum anderen ist deren Verdaulichkeit von Bedeutung, die beim Schwein in Form der praecaecalen Verdaulichkeit angegeben wird.
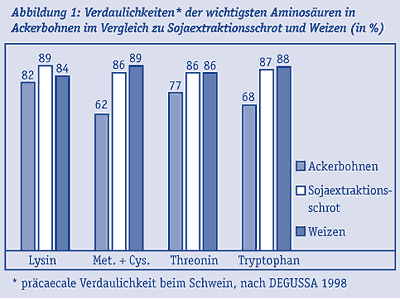

Die absoluten Aminosäuregehalte sind der Tabelle 2 zu entnehmen. Wie alle heimischen Körnerleguminosen enthalten Ackerbohnen wenig schwefelhaltige Aminosäuren (Methionin + Cystin). Getreide hat zwar insgesamt geringere Aminosäurengehalte, in Relation zu Lysin weist es jedoch hohe Gehalte an den schwefelhaltigen Aminosäuren auf. Neben den absoluten Aminosäuregehalten ist deren Verdaulichkeit von Bedeutung. In Abbildung 1 werden die für Schweine geltenden Verdaulichkeiten dargestellt. Besonders Methionin + Cystin der Ackerbohnen ist deutlich niedriger verdaulich als bei anderen Futtermitteln. Weißblühende Sorten weisen allerdings erheblich höhere Aminosäurenverdaulich keiten als buntblühende Sorten auf. Die Ursache hierfür liegt in niedrigeren Gehalten weißblühender Ackerbohnen an Tanninen. Die für die Mischungsberechnungen erforderlichen Angaben zu den verdaulichen Aminosäuren finden sich gleichfalls in der Tabelle 2.

In der Fütterung von Wiederkäuern sind bezüglich der Proteinversorgung folgende Kennwerte von Bedeutung:
- (Pansen)unabbaubares Rohprotein (UDP)
- nutzbares Rohprotein am Duodenum (nXP)
- Ruminale N-Bilanz (RNB)
Die Angaben hierzu sind für die Ackerbohnen und die Vergleichsfuttermittel der Tabelle 3 zu entnehmen.
Bei der Rationsgestaltung ist die in Abbildung 2 gezeigte geringe Beständigkeit der Trockensubstanz im Pansen zu beachten. Innerhalb nur weniger Stunden nach der Aufnahme sind bereits über 80 % der Nährstoffe aus Ackerbohnen ruminal abgebaut, wobei sich allerdings buntblühende Sorten aufgrund der höheren Tanningehalte pansenbeständiger als weißblühende Sorten erweisen. Insbesondere in der Fütterung von Hochleistungstieren, die meist zusätzliche Anforderungen an die Versorgung mit nicht zu hoch abbaubarem Futterprotein stellt, wären buntblühende gegenüber weißblühenden Ackerbohnensorten vorzuziehen. Die sich aus den Abbauvorgängen im Pansen ergebenden, für die Rationsgestaltung erforderlichen Kennwerte für Protein und Kohlenhydrate sind der Tabelle 3 zu entnehmen. Durch hydrthermische Behandlung der Ackerbohnen kann der UDP-Anteil am Ackerbohnenprotein verdoppelt werden (statt 15 % - sie Tabelle 3 - auf bis zu 30 %). Dadurch erhöht sich der nXP-Gehalt um bis zu 17 % und die RNB verringert sich um bis zu 31 %.

Für den energetischen Futterwert sind neben den Nährstoffgehalten deren Verdaulichkeiten maßgebend. Insbesondere das Rohprotein ist bei weißblühenden Sorten höher verdaulich als bei buntblühenden. Hieraus ergeben sich für Schweine höhere ME-Gehalte von weißblühenden Sorten. Für Geflügel und Wiederkäuer findet bei der energetischen Berechnung das verdauliche Rohprotein keine Berücksichtigung mit der Folge vergleichbarer ME-Gehalte für weiß- oder buntblühende Sorten. Dies dürfte jedoch beim Geflügel zu erheblichen Fehleinschätzungen führen. In Fütterungsversuchen an Broilern lagen bei einer begrenzten Zahl von Sorten die ME-Gehalte von buntblühenden gegenüber weißblühenden Sorten um bis zu 20 % niedriger. Weißblühende Sorten wären daher in der Schweine- und Geflügelernährung bei alleiniger Betrachtung der ernährungsphysiologischen Verwertungseigenschaften vorzuziehen. Andererseits sind buntblühende Ackerbohnensorten im Anbau meist widerstandfähiger gegen Pflanzenkrankheiten. Wenn im landwirtschaftlichen Betrieb Ackerbohnen selbst erzeugt werden sollen, sind im Einzelfall die agronomischen und die verwertungsbezogenen Aspekte bei der Sortenwahl zu berücksichtigen. Ein extremes, in Tabelle 4 gezeigtes Beispiel mit zwei Sorten eines Erntejahres soll dies veranschaulichen.
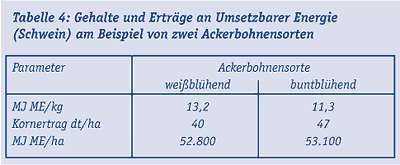
Hinsichtlich Ertrag und Futterwert darf dieses Beispiel selbstverständlich nicht verallgemeinert werden. Es zeigt aber, dass hier der deutlich höhere Futterwert der weißblühenden Sorte durch den höheren Kornertrag der buntblühenden Sorte vollständig kompensiert wurde, so dass im Hinblick auf den Energieertrag pro ha in etwa die gleichen Mengen an ME anfielen.
Empfehlungen zum Einsatz
Ackerbohnen sind für die Fütterung landwirtschaftlicher Nutztiere gut geeignet, wobei die Tierart, die Leistungsrichtung und -höhe, aber auch die Möglichkeiten insbesondere zur Aminosäurenergänzung die Anteile von Ackerbohnen in der Futterration bestimmen. Außerdem müssen Einsatzgrenzen aufgrund von Gehalten an sekundären Inhaltsstoffen wie z. B. Tanninen (Gerbstoffe) oder Vicin (zur Gruppe der Pyrimidinglycoside zählend) beachtet werden.
Die in Tabelle 5 zusammengestellten Empfehlungen beruhen auf Literaturangaben sowie Praxiserfahrungen und tragen den verschiedenen tier- und futtermittelspezifischen Aspekten Rechnung. Sie umspannen relativ weite Entscheidungsbereiche für den jeweils sorgfältig zu beurteilenden Einzelfall. Bei den Einsatzmengen ist ebenfalls zu berücksichtigen, ob gleichzeitig weitere Körnerleguminosen in der Futterration eingesetzt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass es nicht zu einem Mangel in der Versorgung mit Methionin + Cystin kommt.

Preiswürdigkeit
Ob in einem viehhaltenden Betrieb bei verfügbarer Lagerkapazität und technischer Ausstattung zur Herstellung betriebseigener Futtermischungen Ackerbohnen erzeugt, verfüttert, verkauft oder zugekauft werden sollten, richtet sich nach den Erzeugungskosten und dem Marktpreis sowie dem Substitutionswert des Futtermittels. Natürlich lohnt es sich immer, Ackerbohnen zu erzeugen, wenn ein ausreichend über den Erzeugungskosten liegender Verkaufspreis erzielt werden kann. Darüber hinaus gilt: Ackerbohnen erzeugen und verfüttern, wenn der Marktpreis über den Erzeugungskosten und unter dem Substitutionswert liegt; Ackerbohnen erzeugen und verkaufen, wenn der Marktpreis über den Erzeugungskosten und über dem Substitutionswert liegt; Ackerbohnen zukaufen, wenn der Marktpreis unter den Erzeugungskosten und unter dem Substitutionswert liegt.
In den Tabellen 6 und 7 wird die Preiswürdigkeit (Futtervergleichswert) von Ackerbohnen in der Nutztierfütterung für verschiedene Weizen- und Sojaextraktionsschrotpreise aufgezeigt.


Aufgrund der unterschiedlichen Bewertungssysteme bezüglich Protein und Energie ergeben sich für Milchkühe und Mastbullen verschiedene Preiswürdigkeiten. In der Bullenmast besitzen Ackerbohnen eine höhere Preiswürdigkeit als in der Milchviehfütterung. Für die Fütterung von Mastschweinen errechnen sich noch höhere Grenzpreise. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass bei diesem Preiswürdigkeitsvergleich nur das Lysin als erstlimitierende Aminosäure einbezogen wird. Der für Ackerbohnen typisch niedrige Methioningehalt bleibt dagegen unberücksichtigt. In Getreide-Sojaschrotmischungen ist bezogen auf den Bedarf der Schweine per se ein Überschuss an Methionin vorhanden, der das Methionindefizit der Ackerbohnen bei den empfohlenen Mischanteilen kompensiert. Wird aus Gründen der Rohproteinabsenkung in den Futtermischungen reines Lysin eingesetzt, wird auch eine Ergänzung mit reinem Methionin erforderlich, wodurch die Preiswürdigkeit der Ackerbohnen entsprechend verringert wird. Insofern sind die Angaben der Tabelle 7 als Orientierungswerte zu verstehen. Letztlich sind betriebsspezifische Mischungsberechnungen und Optimierungen sinnvoll und notwendig.
Schlussfolgerungen
Ackerbohnen können als Protein- und Stärketräger an alle landwirtschaftlichen Nutztiere verfüttert werden. Die Blütenfarbe liefert wichtige Informationen zur gezielten Wahl von Ackerbohnen für einzelne Nutzungsrichtungen. Buntblühende Sorten gelten als widerstandfähiger gegen bodenbürtige Pflanzenkrankheiten – sie unterstützen auf natürliche Weise den Pflanzenschutz. In der Tierernährung empfehlen sie sich aufgrund höherer Beständigkeit im Pansenstoffwechsel bevorzugt für Wiederkäuer. In der Ernährung von Geflügel und Schwein muss das bekannte Defizit von Ackerbohnen an der Aminosäure Methionin beachtet werden. Bei diesen Tierarten bringen weißblühende Sorten aufgrund höherer Verdaulichkeit Vorteile. Diese Gesichtspunkte sollten beim Anbau und beim Einsatz in der Nutztierernährung stärker als bisher beachtet werden.


 Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen E.V.
Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen E.V.